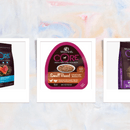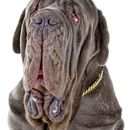Das Cushing-Syndrom, auch bekannt als Hyperadrenokortizismus, ist eine Erkrankung, die bei Hunden auftritt und durch eine übermäßige Produktion von Glucocorticoiden, insbesondere des Stresshormons Cortisol gekennzeichnet ist. Diese Störung kann ernsthafte Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihres Hundes haben.
Was ist das Cushing Syndrom?
Beim Cushing Syndrom, eine der häufigsten Endokrinopathien beim Hund, kommt es aufgrund verschiedener Gründe zu langfristig erhöhten Glucocorticoidspiegeln im Blut führt. Diese sind für die Regulierung vieler Funktionen im Körper verantwortlich, einschließlich des Stoffwechsels und des Immunsystems. Eine Überproduktion kann daher zu verschiedenen Gesundheitsproblemen führen.
Ursachen des Cushing Syndroms
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen der endogenen und der exogenen Form des Cushing-Syndroms. Das endogene Cushing-Syndrom wird in der Regel durch einen Tumor in der Hypophyse oder in den Nebennieren verursacht. Das klinische Bild ist unabhängig der Ursache jedoch gleich.
Die Hypophysenform (Hypophysärer Hyperadrenokortizismus) macht in der Regel mehr als 80% der Fälle aus und betrifft meist mittelalte bis alte, kleinere Hunde. Der Grund ist oft ein ACTH-produzierendes Mikroadenom. Die Nebennierenform (Adrenaler Hyperadrenokortizismus) tritt auf, wenn ein Tumor in den Nebennieren direkt zu einer übermäßigen Cortisolproduktion führt. Hier sind ebenfalls meist ältere Hunde betroffen, jedoch häufiger große Rassen und vermehrt Hündinnen. Der ursächliche Tumor kann zu 50% gut- oder bösartig sein.
Die exogene Form beschreibt, wie der Name bereits aussagt, dass von außen etwas eingeführt wurde. Grund hierfür ist meist die Gabe synthetischer Glucocorticoide (wie Prednisolon oder Dexamethason), die lange oder hoch dosiert verschrieben wurden. Man spricht dann auch vom iatrogenen Cushing-Syndrom.
Seltener beschrieben sind das ektope ACTH-Syndrom, bei welcher es ACTH-produzierende Tumoren gibt, die außerhalb der Hirnanhangsdrüse gibt, sowie das fütterungsabhängige Cushing-Syndrom. Letzteres tritt bei Tieren auf, die in der Nebennierenrinde fehlerhafte Rezeptoren ausbilden. Bei diesen Tieren kommt es nach jeder Nahrungsaufnahme zu einer krankhaft gesteigerten Cortisolbildung.

Symptome des Cushing-Syndroms
Zu den Symptomen des Cushing-Syndroms gehören:
- Erhöhter Durst (Polydipsie)
- Häufigeres Urinieren (Polyurie)
- Erhöhter Appetit (Polyphagie)
- Haarausfall (Alopezie) mit dünner Haut
- Bauchschwellung
- schnelle Ermüdung
- Muskelschwäche
- Infektanfälligkeit
Weitere Symptome können außerdem wiederkehrende Pyodermien, Calcinosis cutis, Hyperpigmentierungen der Haut, aber auch Thromoembolien, ein persistierender Anöstrus und Bänderrisse sein. Wichtig zu erwähnen ist, dass die Ausprägung der Symptome sehr individuell sein kann und manche Hunde starke, andere jedoch sehr schwache bis sogar keine Anzeichen der Erkrankung zeigen.
Diagnose des Cushing-Syndroms
Eine offizielle Diagnose kann nur der Tierarzt stellen. Dieser untersucht in der Regel zunächst mithilfe von Blut- und Urinanalysen, ob ein Verdacht besteht. Dann können verschiedene Tests zum Einsatz kommen, die den Verdacht bestätigen, wie zum Beispiel ein ACTH-Stimulationstest (ACTHST) oder ein Dexamethason-Hemmtest (LDDST).
Häufig ist eine Kombination verschiedener Tests oder eine Wiederholung von diesen notwendig. Außerdem können bildgebende Verfahren (MRT, Sonografien) nützlich sein, um eine detaillierte Diagnose, auch hinsichtlich der Ursache, stellen zu können.

Behandlung des Cushing Syndroms
Die Behandlung hängt von der Ursache ab. Sie muss aber auf jeden Fall überwacht werden, da bei einigen Behandlungsmethoden das Risiko einer Nebennierenunterfunktion (Morbus Addison) besteht. Eine Überwachung durch Bluttests und die Beobachtung durch den Hundehalter spielen eine wichtige Rolle bei der Anpassung der Behandlung und der Sicherstellung einer guten Lebensqualität für das Tier.
Reduzierung der bisherigen Medikamentengabe
Die Behandlung des iatrogenen Cushing-Syndroms erfolgt durch allmähliches Reduzieren der Glucocorticoide, um ein abruptes Absinken der Cortisolproduktion und damit verbundene Risiken zu vermeiden.
Medikamentöse Behandlung
Spontanes Cushing wird vorrangig medikamentös behandelt, wobei Trilostan, das die Cortisolbildung hemmt, das einzige für diese Erkrankung bei Hunden zugelassene Medikament ist. Trilostan muss sorgfältig dosiert werden, um Nebenwirkungen zu vermeiden, und die Behandlung sollte regelmäßig überwacht werden, um die richtige Einstellung zu gewährleisten.
Aber auch bisher experimentelle Therapien wie mit ATR-101, ein selektiver Hemmer, der die ACTH-Produktion blockiert, zeigen vielversprechende Ergebnisse.
Chirurgische Behandlung
In Fällen, in denen ein Tumor die Ursache ist, kann eine chirurgische Entfernung die beste Option sein. Dies ist insbesondere bei Tumoren in den Nebennieren der Fall. Die Operation ist jedoch mit Risiken verbunden und erfordert eine sorgfältige Nachsorge.

Nachsorge nach der Verdachtsbestätigung
Die Nachsorge für Hunde mit Cushing Syndrom umfasst regelmäßige Tierarztbesuche, Bluttests und die Anpassung der Medikation. Eine gute Ernährung und regelmäßige Bewegung sind ebenfalls wichtig, um das Gewicht zu kontrollieren und das allgemeine Wohlbefinden zu fördern.
Das Cushing-Syndrom ist eine ernste Erkrankung, die eine sorgfältige Diagnose und Behandlung erfordert. Mit der richtigen Pflege und Behandlung können jedoch viele Hunde ein langes und gesundes Leben führen. Es ist wichtig, bei Verdacht auf das Cushing Syndrom frühzeitig einen Tierarzt aufzusuchen und einen individuellen Behandlungsplan zu erstellen.
Sollte ich meinen Hund einschläfern bei Cushing-Syndrom?
In der Regel ist das Cushing-Syndrom gut behandelbar und bedeutet kein Todesurteil. Wichtig zu erwähnen ist außerdem, dass das Cushing-Syndrom selbst kein Auslöser für Schmerzen ist. Die Entscheidung, einen Hund mit Cushing-Syndrom einzuschläfern, ist eine sehr persönliche und oft schwierige Entscheidung, die von verschiedenen Faktoren abhängt. Hier sind einige Aspekte, die man bei dieser Entscheidung berücksichtigen sollten:
1. Lebensqualität des Hundes
- Schmerz und Unbehagen: Beobachte, ob dein Hund ständige Schmerzen oder Unbehagen hat, die nicht angemessen behandelt oder gelindert werden können.
- Fähigkeit zu alltäglichen Aktivitäten: Hat dein Hund Schwierigkeiten beim Aufstehen, Gehen, Essen oder bei der Toilettennutzung?
- Interesse und Freude: Zeigt dein Hund noch Interesse an Aktivitäten, die ihm früher Freude bereiteten, wie Spaziergänge, Spielen oder Interaktion mit der Familie?
2. Medizinische Prognose
- Fortschritt der Krankheit: Wie schnell schreitet die Erkrankung voran? Gibt es Behandlungsoptionen, die die Lebensqualität verbessern könnten?
- Nebenwirkungen der Behandlung: Wie wirken sich Behandlungen auf den Allgemeinzustand deines Hundes aus? Sind die Nebenwirkungen der Behandlung schlimmer als die Symptome des Cushing-Syndroms?
3. Beratung durch den Tierarzt
- Professionelle Einschätzung: Dein Tierarzt kann helfen, die Lebensqualität deines Hundes zu beurteilen und die medizinische Prognose zu verstehen.
- Behandlungsoptionen: Erörtere alle verfügbaren Behandlungsoptionen, einschließlich Palliativpflege, um die Symptome zu lindern.
4. Emotionale und finanzielle Überlegungen
- Emotionale Belastung: Berücksichtige deine emotionale Kapazität, sowohl in Bezug auf die Pflege als auch auf die Bewältigung des fortschreitenden Krankheitsverlaufs.
- Finanzielle Aspekte: Manchmal spielen auch finanzielle Erwägungen eine Rolle, insbesondere wenn die Behandlungskosten hoch sind.
5. Qualität statt Quantität
- Fokus auf die Lebensqualität: Oft ist es wichtiger, sich auf die Qualität des verbleibenden Lebens zu konzentrieren, anstatt auf die Verlängerung der Lebensspanne um jeden Preis.
Quellen und relevante Links
Dechra
Abgerufen am 09.02.2024
Royal Canin
Abgerufen am 09.02.2024
LMU München
Abgerufen am 09.02.2024
Sophia A. Yin, Ingo Nolte (2014). Praxisleitfaden Hund und Katze. Schlütersche.
Anne-Rose Günzel-Apel, Hans-Otto Hoppen, Annett Rotermund (2009). Praxis der endokrinologischen Krankheitsbilder bei Hund und Katze. Enke.